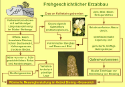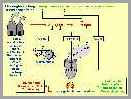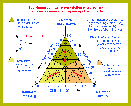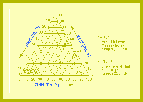Erze und Metalle
zur Frühzeit
Zweifelsfrei für unseren Raum belegt ist der Bergbau
zu
römischer
Zeit. Eine Vielzahl von Bodenfunden lässt höchstens
noch Zweifel offen, welche Erztypen hier zur damaligen Zeit
gefördert
und verarbeitet worden sind.
Insbesondere wenn man sich nun bezüglich einer noch
früheren
Nutzung der hier anstehenden Erzmittel Gedanken macht, muss man
sicherlich zwischen den einzelnen Erzarten differenzieren. Es
ist zunächst einmal sofort einsichtig, dass alle Erze, die
für eine frühe Nutzung in Frage kamen, der Oxydationszone
entstammen mussten, dem oberflächennahen Bereich also, in
welchem die ursprünglichen Primärerze weitestgehend
umgebildet waren. Ein weiterer Ansatzpunkt ergibt sich, wenn man
die in unserem Raum anstehenden Erze nach ihrem Metallgehalt
differenziert,
nämlich nach Eisen, Blei und Zink.
Die drei Unzertrennlichen
Drei Metalle waren es also, die in den unterschiedlichen Erzarten
vorkamen und die Nennung dieser drei Metalle ist durchaus nicht
nur als Aufzählung zu verstehen. Nein, die Erze dieser drei
Metalle sind auf Grund gleicher Bildungsmechanismen und unter
gleichen Bildungsbedingungen entstanden, sie gehören also
zusammen und treten in den Lagerstätten gemeinsam und
nebeneinander
auf; ein Umstand, der mit dem Begriff Paragenese
umschrieben wird. Wenn auch an einzelnen Fundpunkten eine bestimmte
Erzart überwiegen mag, die beiden anderen Vertreter der
Drillingsgruppe
sind, wenn auch im Einzelfall manchmal stark untergeordnet, ebenfalls
immer auch vorhanden, was für unsere Betrachtungen von
Bedeutung
sein wird.
Eisenerz lag in der Oxydationszone vorwiegend in Form des Limonits oder
des Brauneisensteins
vor, der leicht, einfach und mit einer Technik zu verhütten
war, die schon sehr früh angewandt und beherrscht wurde.

Ganz ähnlich lagen die Verhältnisse bei den
anstehenden
Bleierzen. Auch sie konnten mit den recht früh bekannten
Verhüttungstechnologien erschmolzen werden. Dies galt sowohl
für die Sekundärformen (umgewandelter Bleiglanz:
Cerrusit
z.B.) als auch für den primär entstandenen Bleiglanz
selbst, der auch im oberflächennahen Bereich noch recht
dominant
war. Während man über die Bedeutung des Eisens auch
für die frühgeschichtliche Zeit eigentlich kaum Worte
verlieren muss, könnte es sicherlich nicht schaden, hier
bereits etwas über die Verwendung des Bleis zu sagen. Blei
wurde hauptsächlich gebraucht zur Herstellung von Figuren,
Urnen, Schiffsanker (Gewichtsanker), Druckrohre für
Wasserleitungssysteme
und zum Vergießen von eisernen Mauerankern aller Art, die
u.a. auch dazu dienten, größere Steinblöcke
innerhalb
eines Bauwerkes miteinander zu verbinden.

Der dritte im Bunde, nämlich die Gruppe der Zinkerze
hat sich einer Nutzung durch den Menschen aus bestimmten
technologischen
Gründen wohl am längsten verweigert. Und diese
Geschichte,
eine Geschichte um angewandte "HighTech" längst
vergangener Zeiten sozusagen, hat sicherlich eine Sonderbehandlung
verdient.
Kelten und Erze
Zunächst jedoch kommen wir nochmals zurück zu den
deutlich
einfacher zu verhüttenden Eisen- bzw. Bleierzen und vielleicht
vergegenwärtigen wir uns fernerhin, dass unsere Region vor
dem Erscheinen der Römer von keltischen Volksstämmen
bewohnt war. Von den Kelten nun wiederum ist bekannt, dass sie
ein bergkundiges Volk gewesen sind und bezüglich des
Auffindens,
des Abbaus und der Verhüttung von Erzen Kenntnisse
besaßen,
die dem damaligen Stand der Technik durchaus entsprachen. Man
kann sich nun eigentlich kaum vorstellen, dass diese Kelten unsere
Region besiedelt, bewirtschaftet und dauerhaft bewohnt haben sollen,
ohne die wie auf einem Präsentierteller dargebotenen Erze
bemerkt zu haben; hoch begehrte Bodenschätze, aus denen sich
allerlei nützliches Gerät herstellen ließ,
die
sich frei, offen und unverdeckt an der Erdoberfläche zeigten,
die unmittelbar an den Verkehrswegen lagen, so dass man beinahe
darüber stolpern musste und die zudem noch von einer ganz
typischen, unübersehbaren Pflanzengesellschaft
angezeigt wurden. Damit wir uns recht verstehen, keltischer Bergbau
ist für die Stolberger Region nicht eindeutig nachgewiesen,
aber aus den oben genannten Gründen eben sehr wahrscheinlich.
In der Tat geht Schwickerath,
M.(1954) noch einen Schritt weiter und rückt die Ausnutzung
der metallischen Bodenschätze in den Rang eines
siedlungsschaffenden
Faktors. Daraus würde man nun wiederum schließen
müssen,
dass eine Nutzung der Erzvorkommen schon sehr früh eingesetzt
hat und schon seit Beginn der Keltenzeit von entwicklungsbestimmendem
Charakter gewesen ist. Voigt,A.(1956) stellt aus Gründen
mangelnder Beweise keltischen Bergbau in unserer Region
überhaupt
in Frage, obschon er diesem Volksstamm den Status des auf diesem
Gebiet führenden Volkes im Venn- Eifelraum zubilligt.
Da es nun in keiner Weise einer Anschuldigung gleichkommt,
wenn man den Kelten bergbauliche Aktivitäten unterstellt,
muss der Grundsatz 'im Zweifelsfall für den Angeklagten'
hier nicht unbedingt gelten und somit gehen wir getrost
zunächst
einmal von der Möglichkeit einer keltischen Nutzung aus (als
Arbeitshypothese sozusagen), wobei wir nicht Beweise, wohl aber
eine hohe Wahrscheinlichkeit für unsere Annahme in Anspruch
nehmen können.
Diese Annahme bezieht sich zunächst einmal nur auf
die
Nutzung der Eisen- und Bleierze. Wie bereits erwähnt, waren
die Verhältnisse bei den Zinkerzen deutlich komplizierter.
Zu dieser Erzgruppe gehört die primär gebildete Zinkblende
und weiterhin
der durch Zersetzung
entstandene Galmei.
Aus
zwei Gründen war zur damaligen Zeit nur die Verwendung des
sekundär gebildeten Galmeis möglich. Der erste dieser
Gründe resultierte aus den
Lagerstättenverhältnissen:
Die ursprünglich entstandene Zinkblende wurde, wie bereits
bekannt, durch Verwitterungs- (Oxydations-) Erscheinungen in Galmei
umgewandelt, wobei dieser Zersetzungsvorgang logischerweise von
der Oberfläche ausgehen musste. Somit wurde die Zinkblende
bis zu Tiefen von 80 -100 m nahezu vollständig durch Galmei
verdrängt bzw. ersetzt, sie lag daher weit unterhalb des
Grundwasserspiegels und war demzufolge für die frühen
Bergleute nicht erreichbar.

Der zweite Grund für die im Bereich der Zinkerzgruppe
ausschließliche Verwendung des Galmeis war technologischer
Natur. Die chemische Zusammensetzung der Zinkblende, die daraus
resultierenden Verarbeitungseigenschaften und das Verhalten der
Zinkbestandteile ließen eine Nutzung dieses Erztypes nicht
zu. Das Problem der Blendeverhüttung wurde erst sehr viel
später, nämlich gegen Ende des 18. Jahrhunderts
überhaupt
gelöst und war eigentlich erst um 1850 technisch beherrschbar.
Vermutet hatte man schon sehr lange, dass es sich bei der Zinkblende
wohl ebenfalls um ein Erz handeln könne, denn es musste dem
Bergmann auf Grund seines Gewichtes und seines halbmetallischen
Glanzes wie ein nutzbares Fördererz vorkommen. Da es sich
jedoch jedem Verhüttungsversuch hartnäckig
widersetzte,
ging irgendwann das böse Wort von der 'Blende' um, das sich
auf blenden beziehen soll, blenden im Sinne von Vorspiegelung
falscher Tatsachen, arglistiger Täuschung oder
betrügerischer
Hochstapelei. Selbst der wissenschaftliche, aus dem griechischen
stammende Name 'Sphalerit' nimmt Bezug auf diesen Zusammenhang.
Wenn wir jetzt zurückkommen auf unser Galmeierz, so
muss
uns die hervorragende Abbaufreundlichkeit der lokalen
Lagerstätten
eigentlich in allen Aspekten klar werden. Sie waren nicht nur
verkehrstechnisch günstig gelegen, traten nicht nur im Bereich
gelockerter, relativ leicht zugänglicher
Störungszonen
auf, sondern waren zudem von ihrer Schichtung her so angelegt,
dass der damals nutzbare Erztyp genau dort lag, wo der Abbau am
einfachsten oder überhaupt möglich war: an bzw. kurz
unterhalb der Oberfläche.
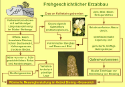
Skizze: F. Holtz
Es gab allerdings bezüglich des Galmeis noch eine
Schwierigkeit,
die bereits kurz angesprochen wurde: Der im Galmei vorhandene
Metallgehalt, nämlich Zink, ließ sich nicht wie bei
anderen Erzen als Metall ausschmelzen, was einer Nutzung in
frühgeschichtlicher
Zeit natürlich entgegenstand.
Zementieren einmal anders
Nun wird man sicherlich jetzt fragen können, wozu denn wohl
ein Erz von Nutzen gewesen sein könnte, dessen Metallgehalt
sich nicht ausschmelzen ließ. Es erscheint heute - im
Gegensatz
vielleicht zu damals - recht einfach, der Zinkgehalt des Galmeis
war nur über einen Umweg zugänglich, über
den technologischen
Umweg der Herstellung einer Legierung (Mischung aus zwei oder
mehr Metallen), wobei das Zink als Reinmetall überhaupt nicht
in Erscheinung trat. Das damals übliche und einzig
mögliche
Verfahren beruhte darauf, dass man unter Einwirkung hoher Temperaturen
und bei (sauerstoff-) reduzierender Atmosphäre die
Zinkbestandteile
freisetzte und man gleichzeitig dafür sorgte, dass die als
Tröpfchen und Gase freiwerdenden Zinkmengen im Schmelztiegel
gebunden wurden, da ansonsten nämlich unter Einwirkung des
Luftsauerstoffes Zinkoxyd entstanden wäre.
Während die reduzierende Atmosphäre durch
Zugabe
von gemahlener Holzkohle erreicht wurde, sorgte die Anwesenheit
von Stückkupfer im Schmelztiegel für eine sofortige
Bindung des Zinks. Diese Bindung ergab sich dadurch, dass die
Kupferstücke vom Zink angelöst
wurden und somit eine
Legierung der beiden Metalle Kupfer und Zink, also Messing entstand.
Bezüglich des eingesetzten Kupfers ist dieses Verfahren
weniger
als Schmelzvorgang, sondern vielmehr als Lösungsprozess
anzusehen,
da sich die eigentliche Legierungsbildung am festen - und eben
nicht am flüssigen - Kupfer vollzieht. Derartige
Vorgänge
werden in der Metallurgie mit Zementation
bezeichnet.
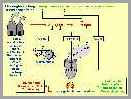
Skizze: F. Holtz
Dieses Verfahren, bei dem sich einer der beiden
Legierungskomponenten
jeglicher Anschauung entzog, hat dann auch prompt zu einiger Irritation
geführt. Noch bis weit in die Neuzeit hinein wurde das
"Brennen"
von Messing nicht als Legierungsprozess erkannt, sondern Galmei
wurde als eine Art Farbstoff angesehen, der dem Kupfer eine goldgelbe
Farbe gab. Konsequenterweise bezeichnete man Messing daher als
gelbes Kupfer.
Die Nachwirkungen dieser Irritationen sind auch heute noch evident,
denn unser Stolberg müsste eigentlich nicht den Namen
"Kupfer"-
sondern Messingstadt tragen. Aber diesen in der Tradition verhafteten
Begriff wird man wohl akzeptieren müssen, wenngleich er die
wirklichen Zusammenhänge recht unbefriedigend beschreibt.
Eine Umgewöhnung von Kupferstadt auf Messingstadt
wäre
ja vielleicht noch vorstellbar, aber die Begriffe "Messingmeister"
oder "Messinghof" würden für jeden Stolberger
ganz einfach ein phonetisches Unding sein.
Unabhängig davon, ob nun das Messing von den
Kupfermeistern
oder sehr viel früher von den Römern gebrannt wurde,
es bleibt noch die Frage zu beantworten, warum die Legierung Messing
so sehr begehrt war, ganz offensichtlich jedenfalls sehr viel
begehrter als das Reinmetall Kupfer. Der Grund hierfür war
zunächst technologischer Natur: Die Messinglegierung
nämlich
lieferte eine sehr viel dünnflüssigere Schmelze und
erlaubte im Gegensatz zum Reinmetall einen blasenfreien Guß.
Man könnte fernerhin vermuten, dass die Nachfrage nach
Messinggegenständen
durch die goldähnliche Farbe im Sinne einer Modeerscheinung
stimuliert wurde.
Messing zur Römerzeit
Ob das technologisch doch schon recht aufwendige Verfahren des
Messingbrennens bereits den Kelten bekannt war, kann durchaus
bezweifelt werden. Die Römer jedenfalls - und das steht
außer
Frage - haben dieses Verfahren des Zementierens beherrscht und
wohl auch im damaligen Germanien angewandt, was sich schon aus
der geographischen Fundortverteilung römischer
Messinggegenstände
ergibt.
Ein wichtiger Hinweis wird allerdings auch von Plinius
gegeben, wenn er als Zeitzeuge in seiner 'naturalis historia'
berichtet, Galmei sei dem Vernehmen nach kürzlich auch in
der Provinz Germanien gefunden worden (...ferunt nuper etiam in
Germania provincia repertum). Somit steht zunächst fest,
dass die Römer schon kurz nach der Zeitenwende auch in
Germanien
Galmei abgebaut haben. Leider gibt Plinius weder an, wo genau
im damaligen Germanien dieser Galmei gefördert wurde, noch
macht er Angaben über den Herstellort des Messings.
Bezüglich des Herstellortes lässt sich nun
wiederum
sagen, dass dieser sich mit hoher Wahrscheinlichkeit in der
Nähe
der Galmeilagerstätten befunden haben muss, da bei den
üblichen
Zinkgehalten des römischen Messings die erforderlichen
Gewichtsanteile
für Kupfer und Galmei in etwa gleich groß waren,
Stückkupfer
sich jedoch erheblich einfacher transportieren ließ. Das
wird insbesondere dann einsichtig, wenn man die unterschiedlichen
Galmeisorten und deren Verarbeitbarkeit etwas näher
betrachtet.
Aus fertigungstechnischen Gründen wird man in der
Frühzeit
nur den extrem oberflächennahen Galmei verwendet haben, da
dieser zu erdigen Massen (Mulm) verwittert war und als Einsatzstoff
für die Messingherstellung einerseits fast ungemahlen
Verwendung
finden konnte, sich andererseits jedoch für den Transport
weniger eignete. Das später verwendete Galmeierz bestand
aus festen, steinigen Aggregaten, die vor ihrem Einsatz als
Zuschlagstoff
mit beträchtlichem Energieaufwand gemahlen werden mussten.
Die Hemmoorer Eimer
Es erscheint offensichtlich auch nicht abwegig, die frühen
Messinggegenstände unter dem heutigen Begriff des 'gehobenen
Bedarfs' einzuordnen. Dies klingt auch bei Werner, J.(1936) an,
wenn dort davon gesprochen wird, dass Messinggerät, zusammen
mit anderen Wertmetallen, häufig Teil von so genannten
Verwahrfunden
gewesen sind. Depots dieser Art, die einen guten Querschnitt
über
damals gebräuchliche Gerätschaften und
Wertgegenstände
repräsentieren, wurden von der römischen
Provinzialbevölkerung
angelegt, die dem Ansturm der germanischen Volksstämme weichen
mussten. Ebenso weist Werner darauf hin, dass Messingwaren und
insbesondere Hemmoorer Eimer zum Hausrat wohlhabender Familien
gehörten.
Bei diesen Hemmoorer Eimern handelt es sich um gegossene,
recht
dünnwandige Töpfe, die aus einer Messinglegierung
bestehen
und deren geographisches Verbreitungsgebiet sich von Skandinavien
bis zum Donauraum erstreckte. Erscheinungsbild und technisch-
handwerkliche Ausführung dieser Gefäße
lassen
auf einen hohen Entwicklungsstand der Messingfertigung
schließen,
und auf Grund der einheitlichen Erscheinungsform sowie
Qualität
wird allgemein angenommen, dass die gefundenen Exemplare dieses
Gefäßtypes allesamt der gleichen Herkunftsregion
entstammen
dürften und dort in räumlich eng beieinandergelegenen
Werkstätten gefertigt wurden. Die auffällige
Dünnwandigkeit
beweist sehr eindrucksvoll, dass man das technologische Potential
der dünnflüssigen Messingschmelze perfekt zu nutzen
wusste.
Häufig sind die Gefäße am oberen
Rand mit einem
umlaufenden, kunstvoll ausgeschmückten Relief-Fries versehen.
Im Bereich dieser Bilderfriese sind teilweise reiche
Silbertauschierungen
(eingehämmertes Silber) und Emaileinlagen angebracht worden,
was den Wert dieser Gefäße natürlich
steigerte.

|

|

|
Hemmoorer Eimer,
Niedersächsisches Landesmuseum
Hannover
|
Die auffällige Ähnlichkeit von Form und
Ausführung
aller gefundenen Exemplare muss bei der ungewöhnlich weiten
räumlichen Verteilung der unterschiedlichen Fundpunkte in
der Tat überraschen und ist nur unter Annahme einer zentralen
Fertigung vernünftig erklärbar.
Berücksichtigt
man fernerhin die Komplexität des Herstellverfahrens, so
dürfte sich auf Grund der erforderlichen Kenntnisse bzw.
Erfahrungen durchaus auch ein Zwang zur Konzentration der
Messingfertigung
ergeben haben. Im Vergleich zu den Messingeimern sind die aus
der gleichen Zeitepoche stammenden Bronzeeimer sehr viel weniger
einheitlich und gleichförmig, so dass man einen weit
lockereren
Zusammenhang zwischen den ausführenden Werkstätten
annehmen
muss, was zwangsläufigerweise auf eine
großräumigere
Verteilung der an der Herstellung beteiligten Werkstätten
schließen lässt.
Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass
- Messing, der zu dessen Herstellung zwingend notwendige
Galmei und ebenfalls die dafür erforderliche Technologie den
Römern auch in Deutschland bekannt gewesen sein
müssen,
.
- die Messingherstellung zentral, wahrscheinlich in
nächster Nähe zu den Galmeivorkommen betrieben wurde,
.
- die Messinglegierung sich einer hohen
Wertschätzung erfreute und
.
- sich mit Messing ein ausgedehnter, einträglicher
Handel betreiben ließ.
Nur vor diesem Hintergrund sollte man eigentlich die Frage
stellen, ob unsere lokalen Erzlagerstätten auch
bezüglich
des zweifelsfrei vorhandenen Galmeis genutzt worden sind. Zwar
ist römischer Bergbau - namentlich für den Bereich
Breinig,
Mausbach, Gressenich - erwiesen, aber ob nun wirklich auch Galmei
abgebaut wurde, lässt sich mit letzter Sicherheit nicht sagen.
Hier spielt uns die bereits erwähnte Paragenese einen Streich,
denn Galmei kam eigentlich immer nur zusammen mit den beiden anderen
Erzarten vor, und es ist nachträglich nicht mehr feststellbar,
welche Erzarten in den frühen Epochen gefördert
wurden.
Eventuell verschmähte Erztypen, deren relative Anreicherung
im Abraum Aufschluss geben könnten, wären - wenn
überhaupt
jemals vorhanden gewesen - natürlich längst zur
willkommenen
Beute späterer Abbauepochen geworden.
Zweifelsfrei belegt ist er also nicht, der römische
Galmeiabbau
in unserer Gegend, ebensowenig wie die häufig vertretene
These, dass die Herkunftsregion der Hemmoorer Eimer hier bei uns
zu suchen ist. Und in der Tat wird der Galmeiabbau zu
römischer
Zeit in der Literatur hin und wieder in Frage gestellt, meist
mit dem Argument, dass er eben nicht erwiesen sei. Aber was
hätte
die Römer denn eigentlich veranlassen können, das
Galmeierz
zu verschmähen, ein Erz,
- das beim zweifelsfrei belegten Abbau auf Eisen und Blei
ohnehin anfiel,
- dessen Besonderheiten sie gekannt haben müssen,
- das im Vergleich zu Erzen mit Kupfer-, Blei- oder
Eisengehalten recht selten war und
- das als Grundlage für hochwertige, begehrte
Handelsgüter diente?
Nein, auch wenn direkte, objektive Beweise nicht vorliegen,
die Römer werden den Galmei wohl selbstverständlich
genutzt haben, der ihnen entweder beim Schürfen anderer Erze
wie ein Geschenk des Himmels in den Schoß fiel, oder den
sie möglicherweise sogar als Hauptfördererz abbauten,
wobei im letzteren Fall dann nicht mehr Galmei, sondern Eisen-
und Bleierze willkommende Nebenprodukte gewesen wären.
Vorstellbar jedoch wäre auch, dass der
Hauptfördererztyp
im Laufe der Zeit von Eisen- bzw. Blei nach Galmei gewechselt
hat. Und genau dieser Wechsel wäre eine durchaus realistische
Möglichkeit, wenn man einmal annimmt, dass den Kelten
einerseits
die Herstellung der frühgeschichtlichen 'HighTech'-Legierung
Messing noch nicht bekannt war, sie andererseits jedoch die Blei-
Eisenerze unseres Raumes bereits genutzt haben.
Was meint denn Plinius dazu?
Vor diesem Hintergrund könnte man jetzt das Plinius-Zitat
etwas näher betrachten. Mit dem von Plinius gewählten
lateinischen Ausdruck "repertum" verhält es sich
nach Frentz, W. und
Holtz, F.
(1995) zunächst ganz ähnlich wie mit dem
deutschen
Begriff "Finden". Es kann ein Finden nach gezielter
Suche bedeuten, es kann jedoch auch ein Finden im
bergmännischen
Sinne von abbauen gemeint sein, wobei auch letztere
Möglichkeit
sich in der heutigen deutschen Umgangssprache als (vor)finden
darstellen lässt; z.B.: "in einer bestimmten Grube werden
bestimmte Erze (vor)gefunden". Bei dem lateinischen Begriff
"repertum" allerdings scheidet eine Möglichkeit
aus, die Möglichkeit nämlich, dass es sich um einen
Zufallsfund gehandelt hat. Derartige Zufallsfunde umschreibt Plinius
ausdrücklich mit "inventum" bzw. "invenitur",
wenn er beispielsweise vom Gold spricht, das man zufällig
findet.
"Repertum" kann also eigentlich nur im Sinne von
"abbauen" oder im Sinne von "auffinden" verstanden
werden. Ein Finden im Sinne von "abbauen" jedoch ist
nur dann einsichtig, wenn man einen vor-römischen, keltischen
Bergbau auf Eisen- und Bleierz annimmt. In diesem Falle
nämlich
hätte man in den existierenden, aufgeschlossenen Gruben sofort
mit dem Abbau (repertum) von Galmei beginnen können.
Selbst wenn wir das "repertum" als "auffinden"
(nach gezielter und bewusster Suche) verstehen wollen,
schließt
das einen vorangegangenen keltischen Bergbau auf Eisen und Blei
überhaupt nicht aus. Denn sicherlich werden die Römer
nicht irgendwann einmal gesagt haben: Nun wollen wir mal nach
Galmei suchen. Nein, wenn schon "repertum" im Sinne
von Auffinden, dann wird man wohl auch systematisch vorgegangen
sein. Das mögliche Prinzip dieser Systematik wird sofort
klar, wenn wir den Begriff der Paragenese nochmals strapazieren.
Das gemeinsame Vorkommen von Zink- und Blei- Erzen ist
überhaupt
keine regionalspezifische Besonderheit, sondern lässt sich
weltweit beobachten. Wenn also die Römer Erfahrungen mit
Galmeiabbau hatten (was erwiesen ist), musste ihnen auch dieser
Zusammenhang bekannt sein. Damit war also ein wichtiger, wahrscheinlich
sogar ein entscheidender Gesichtspunkt zur Auffindung von Galmei
vorgegeben. Die weitere Vorgehensweise ergab sich dann von selbst,
wenn man einen keltischen Bergbau in unserer Region als wahrscheinlich
ansieht. Die Römer brauchten in diesem Fall eigentlich nur
dort nachzusehen, wo die Kelten bereits Bleierze abbauten.
Die Möglichkeit, dass die Kelten bereits den Galmei
zur
Messingherstellung genutzt haben erscheint eher unwahrscheinlich,
wenn wir das Plinius-Zitat nochmals näher betrachten.
Kürzlich
erst, so berichtet Plinius nämlich, sei in Germanien Galmei
gefunden worden, womit ein keltischer Abbau implizit ausgeschlossen
wird. Aber auch die bereits erwähnte Komplexität der
Galmei- bzw. Messingtechnologie spricht dafür, dass Messing
erst zur Römerzeit hier hergestellt wurde.
Messing, ein Edelmetall?
Nun aber vielleicht nochmals zurück zu der
Wertschätzung,
derer sich die Messinglegierung in römischer Zeit erfreute.
Hierzu gibt es interessante Untersuchungsergebnisse und
Interpretationsansätze
aus England, die vom 'Ancient Monuments Laboratory'
veröffentlicht
wurden (Bayley J. (1990) Seiten 7-21, siehe Quellenverzeichnis).
Diese Institution
hat einige hundert Broschen römischer Herkunft von den
verschiedensten
Fundorten untersucht. Wir können uns hier allerdings auf
die Fundstelle Colchester im Südosten Englands
beschränken,
da die allgemeinen Untersuchungsergebnisse der römischen
Broschenfunde in England von den Colchester-Funden nahezu idealtypisch
abgebildet werden.
Ein wichtiger Teil dieser Untersuchungen bestand in der
Analyse
der Legierungszusammensetzungen. Bei näherem Hinsehen, und
das gilt ganz allgemein für viele Kupferlegierungen, reicht
es nicht mehr aus, lediglich zwischen Messing (Kupfer - Zink)
und Bronze (Kupfer - Zinn) zu unterscheiden. Neben Zink, Zinn
und natürlich dem Kupfer selbst war an den üblichen
Kupferlegierungen sehr häufig auch Blei in durchaus
signifikanten
Mengen beteiligt. Damit nicht genug, sehr oft waren neben dem
Grundmetall Kupfer in den Legierungen alle drei Komponenten (Zink,
Zinn und Blei) in wechselnden Mengenverhältnissen enthalten.
Eine übersichtliche Darstellung der
Legierungsverhältnisse
lässt sich eigentlich nur noch durch die Verwendung eines
Dreiecknetzes erreichen. Hierzu wurde die Summe aller
Legierungszuschläge
(ohne Berücksichtigung des Kupfergehaltes) auf 100% normiert,
wodurch jedes beliebige Verhältnis der Zuschlagskomponenten
als Punkt innerhalb des Dreiecksnetzes darstellbar ist. Dabei
allerdings geht die Information bezüglich der Kupferanteile
verloren, was uns jedoch nicht schrecken sollte, da die Kupferanteile
eigentlich immer bei einer Größenordnung von 70%
lagen.
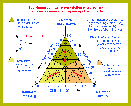
Skizze: F. Holtz
Wenn wir jetzt wieder zurückkommen zu den
erwähnten
Colchester Broschen, so lassen sich hinsichtlich
Legierungszusammensetzung
und Ausführung ganz eindeutig zwei Typen unterscheiden. Es
gab zunächst den so genannten A-Typ, der im frühen
ersten
Jahrhundert gefertigt wurde und den B-Typ, der den anfänglich
gebräuchlichen A-Typ im dritten Viertel des gleichen
Jahrhunderts
nahezu gänzlich ablöste.
Bei dem früher entstandenen A-Typ waren
Broschenkörper
und Befestigungsnadel (letztere musste aus funktionalen
Gründen
federharte Eigenschaften aufweisen) aus einem Stück gegossen
und bestanden meist aus einer Messinglegierung. Nur einige wenige
Exemplare gehen hinsichtlich ihrer Legierungszusammensetzung in
Richtung Bronze. Ganz allgemein lässt sich sagen, dass der
A-Typ relativ wenig Blei enthielt, wodurch die federharten
Materialeigenschaften
der Befestigungsnadel sichergestellt wurden.
Während nun bei dem aus zwei Einzelteilen bestehenden
B-Typ die Befestigungsnadel nach wie vor aus einer bleiarmen
Messinglegierung
bestand, wurde für den Broschenkörper fast
ausschließlich
eine billigere Legierung mit hohen Bleianteilen verwendet.
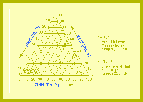
Skizze: F. Holtz
Unabhängig davon, ob man sich durch die Verwendung
einer
preiswerteren Legierung zu einer Änderung im Design (zwei
separate Teile für Broschenkörper und Nadel)
gezwungen
sah, oder ob durch die Änderung im Design eine Verwendung
billigerer Legierungen ermöglicht wurde, die Römer
wussten
die unterschiedlichen Legierungen durchaus differenziert und
zweckentsprechend
einzusetzen.
Letztlich kam man im Zuge dieser Untersuchungen zu einem
zunächst
überraschenden, meines Erachtens allerdings faszinierenden
Schluss. Messing nämlich, so vermutet man, sei für
die
Herstellung von Broschen viel zu kostbar gewesen. Überhaupt
lässt sich beobachten, dass Gegenstände aus Messing
ab der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts zunehmend von
solchen anderer Kupferlegierungen ersetzt wurden. Die Messinglegierung,
so wird gefolgert, scheint als eine Art Edelmetall angesehen worden
zu sein und war offenkundig kaum noch verfügbar, da sie wohl
Gegenstand staatsmonopolistischer Verwaltung gewesen sei.
Wenn das tatsächlich so oder ähnlich der
Fall gewesen
sein sollte, wäre eine römische Nutzung unserer
Galmeivorkommen
zwar immer noch nicht erwiesen, aber es wäre eben immer
schwerer
vorstellbar, dass die Römer gerade den Galmei
verschmäht
haben sollten, der zur Herstellung eines kostbaren Edelmetalls
Verwendung fand.
Aber da ist auch noch etwas anderes: Auch die uralten
Erzählgeschichten
um die Sagenstadt Gression
mit ihrem unermesslichen Reichtum würden in einem neuen Licht
erscheinen, wenn die hier hergestellte Messinglegierung nicht
nur wie Gold glänzte, sondern tatsächlich auch als
Edelmetall
gehandelt worden wäre. Man muss sich das wirklich einmal
vorstellen: Der Hemmoorer Eimer, ein (wie der Name schon sagt)
eimergroßes Prunkgefäß, das
möglicherweise
hier bei uns hergestellt worden ist, hätte demzufolge aus
einer Legierung bestanden, die nach damaliger Auffassung den
Edelmetallen
zuzurechnen wäre. Und dann hätten nicht nur die in
der
Sage anklingenden Bezüge zu einem frühgeschichtlichen
Bergbau reale Hintergründe, sondern auch der
überlieferte
märchenhafte Reichtum. Nun ja, vielleicht ist es
tatsächlich
so gewesen, denn ein Einzelfall wäre es in der Tat nicht,
dass ein Sagenmotiv sehr viel mehr Realität reflektiert,
als man zunächst annehmen würde.
Weniger spekulativ allerdings ist ein anderer Aspekt.
Gleichgültig
ob das Imperium Romanum nun als Schutzmacht oder als Besatzungsmacht
anzusehen war, die Zeit des römischen Reiches brachte in
Europa und natürlich auch für unsere Region eine
langandauernde
Epoche stabiler und friedlicher Verhältnisse. Nicht nur dass
sich Handel und Wandel bestens entwickeln konnten, nein, auch
die nicht- römische Bevölkerung hatte sich
größtenteils
mit den Römern arrangiert, partizipierten durchaus auch am
erwirtschafteten Wohlstand und wussten sicherlich ebenfalls die
Vorteile eines wohlgeordneten Staatswesens zu schätzen.
So ist es kaum verwunderlich, dass der Glanz dieser Zeit
hinüberstrahlte
auf nachfolgende, weniger ruhige Epochen, und dass der
tatsächlich
vorhandene, oder aber der durch die Überlieferung
verklärte
und überzeichnete, märchenhafte Reichtum, der mit der
Sagenstadt Gression unwiederbringlich untergegangen war, als Erinnerung
an bessere Tage in den Erzählgeschichten weiterlebte.
Ob nun Gebrauchsmetall, Wertmetall oder vielleicht sogar
Edelmetall,
die Messinglegierung war, wie bereits erwähnt, zur Herstellung
gegossener Artikel bestens geeignet. Und genau hierauf hatten
sich die Römer spezialisiert. Diese Spezialisierung erlaubte
eine sehr enge räumliche Anbindung der
Produktionsstätten
an die Erzvorkommen; eine Anbindung, die sich während
späterer
Epochen nie wieder in ähnlicher Unmittelbarkeit eingestellt
hat. Dies gibt Anlass, sich vielleicht einmal über die Lage
der Metallproduktions und -verarbeitungsstätten zu
römischer
und zu späterer Zeit Gedanken zu machen.
Erze und Energie
Zunächst einmal waren selbstverständlich zu allen
Zeiten
die heimischen Erzlagerstätten Grundlage für die
regionale
Buntmetallerzeugung und -verarbeitung. Dies lässt sich mit
Fug und Recht sogar für die jüngere Vergangenheit und
ebenfalls auch noch für die Gegenwart behaupten, obschon
die lokalen Erzvorkommen zur Neige gegangen und seit nunmehr
über
70 Jahren nicht mehr verfügbar sind. Die Wurzeln der heute
hier ansässigen Metallindustrie reichen zweifelsohne weit
zurück in die Zeit des hiesigen Erzabbaus, und der auch heute
noch erfolgreiche Zweig der Metallverarbeitung muss wohl als
Fortführung
eben dieser Tradition angesehen werden. Die konkrete Standortwahl
innerhalb unserer erzführenden Region, die genaue
lokalgeographische
Fixierung der Standorte innerhalb des regional vorgegebenen Rahmens
also, ist nun allerdings fast ausschließlich und zu allen
Zeiten bestimmt gewesen von den jeweils vorliegenden
Energiebedürfnissen.

Skizze: F. Holtz
Die von den Römern überwiegend angewandte
Metallgießtechnik
benötigte als Energiequelle lediglich Klafterholz zum Beheizen
der Öfen und als Zuschlagstoff Holzkohle
(Reduktionsmittel
bei
der Zementierung).
Von der Holzkohle nun wiederum wissen wir, dass zu deren Herstellung
Buchenholz am allerbesten geeignet war. Buchenholz also werden
auch die Römer zur Gewinnung der Holzkohle vorzugsweise
verwendet
haben, und hier müsste uns eigentlich sofort wieder der
Kalkbuchenwald
einfallen, der sich überall in unmittelbarer Nähe der
Erzlagerstätten erstreckte. Auch in diesem Zusammenhang sollte
uns nochmals wieder klar werden, wie außerordentlich
vielfältig
der Einfluss unserer buchenwaldtragenden Kalksteinzüge gewesen
ist.
Zu römischer Zeit konnten also die gewonnenen Erze
und
Metalle in unmittelbarer Nähe der Schürfgebiete auch
verarbeitet werden und es bestand keinerlei Veranlassung, die
erzführenden, verkehrsfreundlichen Kalksteinzüge zu
verlassen. Schürfstellen, Produktionsstätten,
Siedlungsstätten
und Verkehrswege bildeten somit eine Einheit, ganz im Gegensatz
zu späteren Epochen.
Für die Produktionspalette der Kupfermeister
beispielsweise
waren gehämmerte und ausgetriebene Messingwaren kennzeichnend,
zu deren Herstellung mechanische Energie benötigt wurde.
Und diese wiederum ließ sich in ausreichender Menge
eigentlich
nur durch die Wasserkraft der Bäche gewinnen und konnte auch
nicht über nennenswerte Entfernungen übertragen
werden.
Zwar kannte man Feldgestänge (auch
Feldkünste oder
Stangenkünste genannt), jedoch wurden diese wegen der
zwangsläufig
auftretenden, hohen Energieverluste ausschließlich in den
Bergbauregionen eingesetzt, wo die Sachzwänge der
Geländebeschaffenheit
und der Lagerstättenverhältnisse einen Transport
(Übertragung)
der Energie zum Abbauort erforderlich machten. In den Stolberger
Erzfeldern allerdings konnte der nahe an der Oberfläche
lagernde
Galmei ohne großen Aufwand an mechanischer Energie abgebaut
werden.

|
Kupferstich von Wichmann J.
in Löhneyß G.E.(1690):
Feld- oder Stangenkunst |
Es war also überhaupt keine Frage, die Kupfermeister
siedelten
natürlich, ganz im Gegensatz zu den Römern, nicht
mehr
direkt an den Schürfstellen, sondern entlang der
Bachläufe,
wo das benötigte Antriebswasser direkt zur Verfügung
stand. Der Galmei wiederum ließ sich recht einfach
transportieren,
sehr viel besser jedenfalls als die mechanische Antriebsenergie.
Im Zuge der weiteren Industrialisierung
und mit der Verfügbarkeit von Dampfmaschinen wechselte der
Hauptenergieträger erneut und damit auch der bevorzugte
Standort.
Die Kohle
wurde zunehmend
zum Primärenergieträger und die Industriestandorte
(auch
die der Metallindustrie) orientierten sich an die Kohlevorkommen
von Münsterbusch,
Atsch, Birkengang
(Eschweiler
Kohlberg).
Zur Zeit der Frühindustrialisierung entstanden hier Zinkhütten,
Glashütten und Betriebe der Großchemie.
Weiter